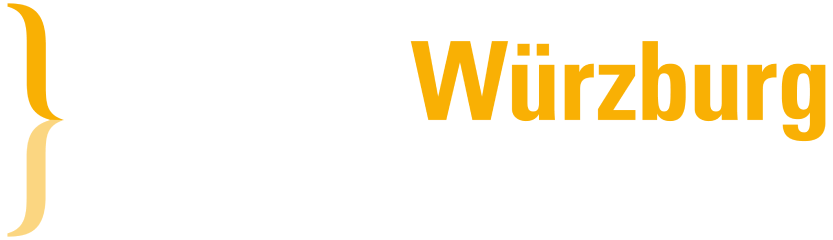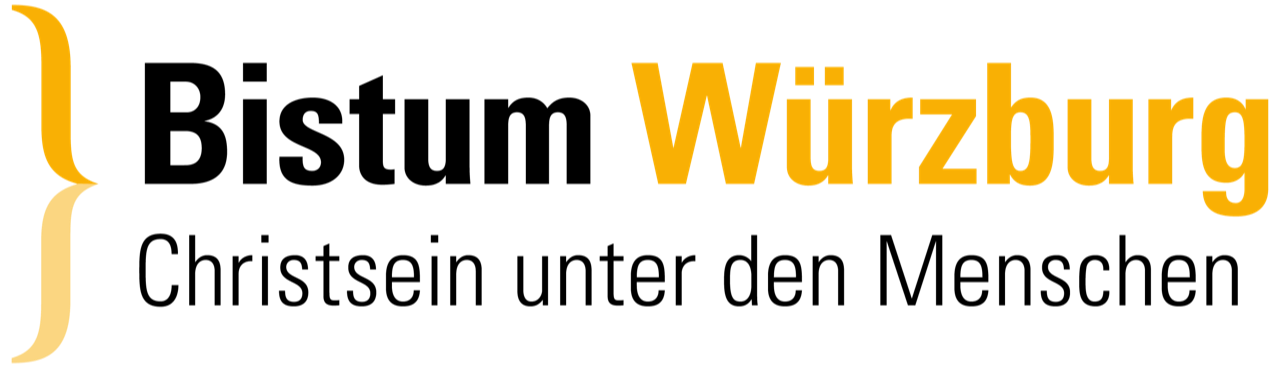Liebe Schwestern und Brüder in ökumenischer Verbundenheit,
wie passt ein lutherisch aufgewachsener Mann, der zum römisch-katholischen Glauben konvertierte und Priester des Bistums Würzburg wurde, dann jedoch als Pfarrer von Altenmünster in den Wirren des 30-jährigen Krieges grausam ermordet wurde, noch in die heutige Zeit? Diese Frage stellte ich mir schon vor langer Zeit, als ich als Student in Würzburg mit der Seligsprechung Liborius Wagners im Jahr 1974 in Kontakt kam. Der Name war mir als gebürtiger Bürger Schonungens durch den gleichlautenden Trägerverein der Kindertagesstätte geläufig - und auch die 1979 gegründete Sozialstation mit dem gleichen Patron, in deren Vorstand ich lange mitgearbeitet habe und deren Vorsitzender ich seit 2021 bin, hat mich motiviert, sich dieses Themas anzunehmen. Trotzdem ist insgesamt ein Rückgang der Verehrung dieses Seligen festzustellen - die nach ihm benannte Kapelle im Dom zu Würzburg wird leider inzwischen anderweitig genutzt.
Das 50-jährige Jubiläum der Seligsprechung in diesem Jahr 2024 ist ein guter Anlass, sich erneut mit Liborius Wagner zu beschäftigen -was schon in vielen Veranstaltungen und einer eigenen homepage geschehen ist. Mit meinem Vortrag will ich vor allem die ökumenischen Bezüge in den Mittelpunkt rücken, aber auch den Zusammenhang mit Schloss Mainberg herausstellen. Zuvor sind jedoch die damaligen Zeitumstände und ein kurzer Lebenslauf dieses Priesters zu erörtern, bevor ich genauer auf das Martyrium im Schloss Mainberg eingehe. Der ökumenische Bezug ergibt sich dann besonders aus dem sog. „Brief von Craheim“ aus dem Jahr 1974, den ich zum Mittelpunkt meiner Ausführungen machen werde.
1. Der historische Hintergrund
Wie waren die Zeitumstände zur Zeit Liborius Wagners, der von 1593 bis 1631 gelebt hat? Die Reformation durch Martin Luther ab 1517 hat zu einer konfessionellen Spaltung des „Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation“ geführt - nicht nur in römisch-katholische Gebiete, sondern auch in lutherische und reformierte Territorien, in denen seit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 der bekannte Grundsatz galt: „cuius regio - eius religio“. Das bedeutete, dass sich der Bewohner einer weltlichen Herrschaft nach der Religionszugehörigkeit ihres Landesherrn zu richten hatte - oder auswandern musste. Gerade im kleinteiligen Unterfranken - und besonders in den oft winzigen Rittergütern östlich von Schweinfurt - entwickelten sich wegen mehrerer Herrschaften in einem Ort auch konfessionell verschieden geprägte Familien - was zu einer Quelle ständigen Streits führte.
Nach der katholischen Gegenreformation - im Hochstift Würzburg vor allem unter Fürstbischof Julius Echter - wurde die politische Lage im deutschen Reich immer aufgehetzter, was dann in den Beginn des 30-jährigen Krieges ab 1618 mündete. Hatten zunächst die katholischen Fürsten die meisten militärischen Erfolge zu verzeichnen, änderte sich das mit dem Einmarsch der Truppen des schwedischen Königs Gustav Adolf völlig. Der Fürstbischof floh - Franken stand von1631 - 1634 unter protestantischer Herrschaft, zunächst direkt einer schwedischen Besatzungsmacht, ab 1633 für ein Jahr unter der Regierung des Fürsten Bernhard von Sachsen -Weimar, bis dann katholische Truppen die Rückkehr des Fürstbischofs ermöglichten. Die Folgen für die Bevölkerung waren enorm - man geht davon aus, dass bald die Hälfte an unmittelbaren Kriegsfolgen, Seuchen und fehlender Nahrungsgrundlage starben. Erst mit dem Westfälischen Frieden von 1648 endete dieser längste Krieg in der deutschen Geschichte.
Wie sah es konkret in Altenmünster und Umgebung in dieser Zeit religiös und politisch aus? Das kleine fast vollständig protestantische Dorf unterstand dem dediziert lutherischen Reichsritter Philipp Albrecht Truchseß von Wetzhausen - wenn auch einige katholische Familien dort wohnten. Die zur Pfarrei Altenmünster gehörende FilialeSulzdorf war dagegen rein katholisch geprägt und bewohnt. Noch ein Satz zu Schloss Mainberg! Dieses war in seiner heutigen Gestalt von Herzogin Margarethe von Braunschweig-Wolfbüttel Ende des 15. Jahrhunderts als ihr Witwensitz umfassend erweitert und renoviert worden. 1542 tauschte der amtierende Graf von Henneberg-Schleusingen mit dem Fürstbischof von Würzburg das Amt Mainberg gegen die Stadt Meiningen - das Schloss wurde seither von einem fürstbischöflichen Amtmann bewohnt - natürlich nicht in der Zeit der schwedischen Besatzung.
2. Der Lebenslauf Liborius Wagners
Liborius Wagner wurde am 15. 12. 1593 in der Freien Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen als Sohn des Schneidermeisters und zeit- weisen Ratsherrn Paul Wagner und dessen Ehefrau Sybille geboren und am gleichen Tag getauft. Seine Eltern lebten streng protestantisch - und auch Liborius wurde in dieser Konfession erzogen. Er besuchte von ca. 1600 - 1612 die Lateinschule in Mühlhausen, was für seine Begabung und auch gewisse finanzielle Mittel seiner Familie spricht. Liborius beherrschte Latein fließend und war mit der antiken Mythologie wie auch der christlichen Theologie vertraut.
1613 bat Liborius den Rat der Stadt Mühlhausen um ein Studienstipendium und unterstrich seinen Antrag mit einem Hymnus an den Heiligen Geist, in dem er diesen als den wahren und einzigen Lenker der Wissenschaften pries - gerade für Studenten besonders wichtig; ihm allein wolle er sich anvertrauen. Das Stipendium wurde zugesagt, so dass Liborius von 1613 - 1619 in Leipzig, Gotha und Straßburg sich eine umfassende Bildung in den Freien Künsten erwarb und 1617 den Abschluss als Magister erreichte. Er blieb bis 1619 in der protestantischen Metropole im Elsass.
Zurückgekehrt nach Mühlhausen, bemühte er sich um eine Anstellung als Lehrer an der örtlichen Lateinschule, was der Rat der Stadt ablehnte, um ihm eine weiterführende Karriere zu ermöglichen. Liborius lebte bei seinen Eltern und widmete sich vermehrt theologischen Studien. Über diese Zeit des Umbruchs in seinem Leben gibt es keine schriftlichen Zeugnisse - von einem Ringen um Fragen des Glaubens kann jedoch ausgegangen werden. 1622 verlässt Liborius für immer Mühlhausen - er hat seit dieser Zeit keine Verbindung mehr zu seinen Eltern, was diese in ihrem Testament erwähnen, zumal seine Geschwister bereits verstorben waren. Er beginnt an der Universität in Würzburg, die von Jesuiten geleitet wird, das Theologiestudium und konvertiert 1623 zur römisch-katholischen Kirche. Da er bereits Magister der Philosophie war, verkürzte sich sein Studium erheblich, so dass er am Pfingstsamstag 1625 zum Priester geweiht wurde. Nach einer Kaplanszeit in der gerade wieder katholisch gewordenen Stadt Hardheim (heute Landkreis Buchen) wurde er zum Pfarrer von Altenmünster mit Filiale Sulzdorf ernannt und begann seine Tätigkeit dort am 11. September 1626.
Wie schon ausgeführt, war Altenmünster zum größten Teil durch die Dorfherrschaft der Truchsesse von Wetzhausen lutherisch geprägt. Auch die protestantischen Familien mussten bei Kasualien, d.h. Taufen, Eheschließungen und Begräbnissen grundsätzlich den katholischen Pfarrer aufsuchen - was wohl auch manchmal umgangen wurde und für Liborius eine aufreibende Tätigkeit bedeutete. Er wollte sicherlich seine Pfarrangehörigen zum katholischen Glauben zurückführen, sorgte sich aber immer auch um die lutherischen Gläubigen. Er wollte nie mit Gewalt, sondern mit Überzeugung handeln - deshalb hielt er wenig von der 1629 von Soldaten des Fürstbischofs von Würzburg erzwungenen Konversion von 13 lutherischen Einwohnern Altenmünsters. Seine eigenhändigen Berichte an den Würzburger Geistlichen Rat zeugen von seinem gewissenhaften Dienst. Liborius bemühte sich in einer Zeit religiöser Zerstrittenheit und Verwirrung um den menschlichen Ausgleich und gleichzeitig um die Klarheit des Glaubens.
Nun kam aber die schwedische Besatzung des Hochstifts Würzburg im Oktober 1631. Pfarrer Liborius Wagner blieb solange wie möglich in seinem Pfarrort und versteckte sich dann in Reichmannshausen -nur 5 km von Altenmünster entfernt. Er wurde jedoch an eine Truppe von lutherischen Soldaten unter dem Kommando der Truchsesse von Pommersfelden am 3. Dezember 1631 verraten und von dieser auf den Amtssitz Schloss Mainberg verschleppt - angeblich, um dem Dorfherrn Philipp Albrecht Truchsess von Wetzhausen einen Gefallen zu tun. Nun begann für Liborius ein fünftägiges Martyrium, das einer Horrorbeschreibung gleicht. Immer wieder wurde er gefragt, ob er dem katholischen Glauben abschwören würde - doch er antwortete: „Ich lebe, leide und sterbe päpstlich-katholisch.“ Am 9. Dezember 1631 wurde er auf den Mainwiesen bei Schonungen - ganz in der Nähe des Fährhauses - erstochen; sein Leichnam wurde in den Main geworfen.
3. Verehrung und Seligsprechung
Nach seinem Tod wurde der Leichnam Liborius Wagners um Ostern 1632 von Fischern geborgen und auf den Mainwiesen beigesetzt. Nach dem Abzug der schwedischen und weimarischen Truppen wurde er in die Schlosskapelle Mainberg überführt und bald darauf im Augustinerchorherrenstift Heidenfeld gemäß einer Anordnung von Fürstbischof Franz von Hatzfeld beigesetzt - ab 1661 in einer Wandnische mit einem Bronzerelief, das noch heute erhalten ist. Bereits 1654 hatte der Geistliche Rat in Würzburg Augenzeugenberichte über das Martyrium gesammelt. Mit der Sakularisation 1804 wurde die Stiftskirche abgebrochen - die Gebeine Liborius Wagners wurden in die Pfarrkirche Heidenfeld übertragen, wo sie sich noch heute befinden.
Das Gedenken an Liborius Wagner ging in der folgenden Zeit stark zurück - erst 1926 begann der Seligsprechungsprozess auf diözesaner Ebene, der sich in Rom mit Verzögerungen durch den Zweiten Weltkrieg lange hinzog. Am 24. März 1974 war es dann soweit: Papst Paul VI. verkündete feierlich die Seligsprechung Liborius Wagners. Zu diesem Anlass war ein Sonderzug des Bistums Würzburg nach Rom gefahren - ich war nicht dabei, kenne jedoch einige der noch lebenden Zeitzeugen.
Der Name „Liborius Wagner“ und einige Daten zu seinem Leben waren mir als Jugendlicher vertraut, da die Kindertagesstätte in Schonungen diesen Namen trug und sich im „Liborius Wagner Haus“ aus dem Jahr 1931 befand. In der Schonunger Ortsgeschichte von 1966 hat der damalige Pfarrer Josef Ryba einen genauen Bericht über die grausame Folterung und Tötung Liborius Wagners aufgenommen, den ich als Schauergeschichte empfand. Als Student der Rechtswissenschaft in Würzburg erlebte ich 1974 einige Gottesdienste mit, die der Vorbereitung der Romfahrt dienten. In Heidenfeld und in Altenmünster wurden die Altäre neu gestaltet - etliche Dekanatswallfahrten führten nach Altenmünster - und auf dem Fußweg zwischen Schonungen und Mainberg, dem sog. „Leinritt“, wurde auf Höhe des Fährhauses ein Denkmal errichtet. Schließlich wurde die 1979 gegründete Sozialstation mit diesem Namen versehen, den sie bis heute führt.
Insgesamt ist jedoch ein Rückgang der Verehrung Liborius Wagners festzustellen - bis auf den örtlichen Bereich um Altenmünster und Heidenfeld. Der Pastorale Raum „Schweinfurter Oberland“ hat aber diesen Seligen zu seinem Patron erwählt.
4. Der „Brief aus Craheim“ 1974
Nachdem inzwischen 50 Jahre seit der Seligsprechung Liborius Wagners vergangen sind, dürfte es an der Zeit sein, auch auf einen besonderen ökumenischen Aspekt genauer hinzuweisen, der seit 1974 ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Ich meine damit den „Brief aus Craheim“, der sich vor allem den ökumenischen Bezügen widmet. Dazu sind aber einige Vorbemerkungen über Craheim und dessen Geschichte notwendig.
Das Schloss Craheim wurde 1910 zwischen den Dörfer Birnfeld, Mailes und Wetzhausen auf einer kleinen Anhöhe errichtet. Es beherbergt seit 1968 das „Lebenszentrum für die Einheit der Christen“ mit einer ökumenischen Gemeinschaft, die in veränderter Form noch heute besteht. Das Schloss Craheim gehört noch heute zur Familie der Truchsesse von Wetzhausen.
Das „Wort des Lebenszentrums für die Einheit der Christen, Craheim, Wetzhausen, zur Seligsprechung von Liborius Wagner“ vom 4. Februar 1974 ist unterzeichnet vom evan.-luth. Fürsten Albrecht zu Castell-Castell, einem Gründungsmitglied des Lebenszentrums, dem evan.-luth. Pfarrer Arnold Bittlinger, der die Akademie Craheim leitete, dem evan.-luth. Crafft Freiherr Truchsess zu Wetzhausen, der übrigens in Rom an der Seligsprechung teilgenommen hat, dem holl.-ref. Pfarrer Dirk Bouman, dem griechisch-orth. Pater Athanasius Emmert, den evan.-luth. Pfarrern Dieter Koller und Wolfram Kopfermann, dem röm.-kath. Pater Eugen Mederlet OFM und dem röm.-kath. Pfarrer von Altenmünster Oskar Kern. Die Sprache dieses Briefes ist vielleicht heute etwas ungewöhnlich - der Inhalt hat aber damals wie heute eine erhebliche Bedeutung.
Ich bitte nun, den Text des „Briefes aus Craheim“ auszuteilen, damit Sie ihn mitverfolgen können, wenn ich ihn nun vorlese - er wird auch über den Beamer gezeigt:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wort des Lebenszentrums für die Einheit der Christen
Craheim, Wetzhausen,
zur Seligsprechung von Liborius Wagner
Anlässlich der Seligsprechung des Pfarrers von Altenmünster, Liborius Wagner, ermordet am 9.12.1631, bitten die Mitarbeiter vom Lebenszentrum für die Einheit der Christen, Craheim, folgendes zu beherzigen:
1. Liborius Wagner war ein Opfer der Kirchenspaltung.
Er darf nicht noch einmal zum Anlass der Entfremdung und Entzweiung unter uns werden. Er hat diese Spaltung in seinem innersten Gewissen und unter schärfsten körperlichen Qualen durchlitten.
Was Protestanten an Liborius Wagner getan haben, haben in vielen Fällen auch Katholiken evangelischen Glaubensbekennern angetan. Das taten sie nicht, weil sie Protestanten oder Katholiken waren, sondern weil sie hierin nicht als gläubige Christen handelten. Wir sind alle die gemeinsamen Erben solcher Schuld und sind auch heute zu ähnlichen Untaten fähig (man denke nur an Irland), wenn wir nicht die persönliche Verbindung mit Christus haben. Niemand von uns, der nicht selber unter der immer noch bestehenden Trennung und Entfremdung der Kirchen leidet hat das Recht, über den Mann Liborius Wagner, über seine Peiniger und über die damalige wirre Zeit ein Urteil zu fällen. Es war eine schlimme Zeit, es gab auf beiden Seiten viel Licht und viel Finsternis. Die damalige schwierige Rechtslage war in unserer Gegend besonders verworren und führte wie von selbst zu Verfolgungen, weil es für den einzelnen keine Gewissensfreiheit gab.
Keiner von uns weiß, auf welcher Seite und in welchem Geist oder Ungeist er damals gestanden hatte. Solange wir Heutigen nicht einander in Ehrfurcht und Liebe zugetan sind, werden uns die alten Schatten noch weiter beherrschen.
Liborius Wagner war ein Vorbote der Oekumene.
Wir alle kennen die biblische Geschichte, wie Joseph von seinen Brüdern geschändet und verkauft wird und wie derselbe Joseph, zum Kanzler Ägyptens erhoben, seinen Brüdern entgegentritt mit den Worten: "Ich bin Joseph, euer Bruder. Bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich euch zürne; denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch vorausgesandt."
So können wir Liborius Wagner als einen der vielen katholischen, evangelischen und freikirchlichen Vorboten Gottesverstehen, die Gott zur Vorbereitung unseres oekumenischen Zeitalters ausgesandt hat und deren Blutvergießen uns im Namen Christi bittet: "Lasst euch versöhnen mit Gott"!
Liborius Wagner gehört der ganzen Christenheit
- unabhängig von einer römisch-katholischen Seligsprechung. Er gehört uns allen, weil er ein Vorbild für lebendigen Glauben und ein Vorbild für letzte Gewissenstreue gab, denn gegen das Gewissen zu handeln ist unter allen Umständen Sünde.
In unserer Zeit der gedankenlosen Umweltanpassung, der gedankenlos übernommenen Tradition und der Ausrichtung an materiellen Vorteil, brauchen wir Vorbilder wie Liborius Wagner.
Die Seligsprechung von Liborius Wagner hat dabei nicht den Sinn, das Unrecht aufzuzeigen, das an ihm geschehen ist, sondern seinen Glauben und seine Liebe als Beispiel hinzustellen, wie wir in unserer ebenso verworrenen Zeit den Glauben leben und bekennen sollen. Die Seligsprechung bedeutet für die Katholiken auch die Erlaubnis, ihn mit Sicherheit unter der Schar der Vollendeten zu wissen, die für uns alle vor Gottes Thron stehen.
Liborius Wagner gehört uns allen, weil uns die Sünden unserer Väter und die Sünden unserer eigenen Gegenwart aneinanderbinden.
Glücklich wäre diese Schuldenlast zu nennen, wenn sie uns gemeinsam unter die- seligmachende Versöhnung des gemarterten Hohenpriesters Jesus Christus triebe, der der Hirte der ganzen Kirche ist und an jedem Ort nur eine einzige Herde hat.
Die Seelen unserer entschlafenen Väter mögen ruhen im Frieden, und das ewige Licht leuchte ihnen, uns allen und unseren Kindern.
Craheim, den 4. Februar 1974
Pfarrer Arnold Bittlinger, evang. luth.
Pfarrer Dirk Bouman, holl. ref.
Albrecht Fürst zu Castell-Castell, evang. luth.
Pater Athanasius Emmert, griech. orth.
Pfarrer Oskar Kern, röm. kath.
Pfarrer Dieter Koller, evang. luth.
Pfarrer Wolfram Kopfermann, evang. luth.
Pater Eugen Mederlet OFM, röm. kath.
Crafft Freiherr Truchsess von und zu Wetzhausen, evang. luth.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Was fällt an diesem ökumenischen Manifest auf? Zunächst betonen die Verfasser, dass Liborius Wagner ein Opfer der Kirchenspaltung war, und dass er nicht noch einmal ein Anlass zur Entfremdung und Entzweiung werden dürfe. Der Brief bezeichnet Liborius Wagner als einen „Vorboten der Ökumene“ - zusammen mit vielen anderen katholischen, evangelischen und freikirchlichen Christen - er gehöre der ganzen Christenheit - unabhängig von der Seligsprechung. Denn diese habe nicht den Sinn, das Unrecht aufzuzeigen, das an ihm geschehen ist, sondern seinen Glauben und seine Liebe als Beispiel für die aktuelle Zeit hinzustellen.
Wie würde ich diesen Text bewerten? Zunächst einmal als sehr offen und wohlwollend im Duktus - dann in einer Sprache, die heute manches vermutlich anders beschrieben hätte - und schließlich sehr ökumenisch ausgerichtet. Weiterhin ist der Kreis der Unterzeichner von einer sehr unterschiedlichen Bandbreite an Kirchen und Konfessionen geprägt. Inhaltlich sehe ich jedoch in diesem Brief aus Craheim eine gewisse Vereinnahmung Liborius Wagners im Sinne einer Abgrenzung des Christentums gegenüber einer feindlichen Umwelt und die starke Betonung der „Sünden der Väter und der Sünden unserer eigenen Gegenwart“. Dabei kommt der charismatische Grundzug der Lebensgemeinschaft wie auch eine evangelikale Deutung zum Vorschein, was nicht abwertend gemeint ist, jedoch definiert werden muss.
5. Nachwirkungen und aktuelle Situation
Im Gegensatz zum „Brief aus Craheim“ hat der Landeskirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern am 28. 5. 1974 sich recht kritisch mit der Seligsprechung befasst und befürchtet, dass damit eine „Versteifung der interkonfessionellen Beziehungen“ eintreten könnte. Darauf antwortete Prälat Michael Höck, der damalige Vorsitzende der Ökumenischen Kommission der Erzdiözese München-Freising am 6. 6. 1974 und bezeichnete diese Befürchtung als ein anachronistisches Missverständnis“. Danach wurde es sehr ruhig um diese Fragen - was auch mit der sehr lokal begrenzten Verehrung zutun hat.
Im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre Seligsprechung 2024“ hat sich der emeritierte Professor für fränkische Kirchengeschichte Dr. Wolfgang Weiß in einem Vortrag skeptisch gegen eine Deutung Liborius Wagners als Pionier der Glaubens- und Meinungsfreiheit ausgesprochen, was er auch schon in einem 2011 veröffentlichten Sammelband zur Geschichte des Schlosses Mainberg betont hat: „Liborius Wagner kann kaum als Vorläufer der religiösen Toleranz interpretiert werden.“
Eine etwas andere Bewertung hat Pfarrer Dr. Eugen Daigeler, der Nachfolger als Pfarrer von Altenmünster, in seinem Gebetsbuch „Gelebte Treue“ vorgenommen. Er spricht davon, dass im Leben dieses Seligen „das urchristliche Geheimnis der Erlösung aufleuchtet“. Und er fährt fort mit dem Gedanken, dass Liborius Wagner allen Menschen zuruft: „Öffnet eure Herzen, euer Leben seiner erlösenden Macht. Allein in seiner Barmherzigkeit und im Geschenk der Versöhnung ist Leben und Zukunft zu finden.“
Viele dieser Gedanken finden sich in einem Bericht des Katholischen Sonntagsblatts der Diözese Würzburg von Ende März 2024 (Nr. 11) verfasst von Herrn Stefan Römmelt. Die dortige Überschrift „Ein ökumenischer Seliger?“ - also mit Fragezeichen - kann m.E. nicht eindeutig beantwortet werden. Davon unabhängig ist es jedoch gerade auch eine Aufgabe unserer Zeit, sich um ökumenische Zusammenarbeit zu kümmern und den Geist Gottes um seinen Beistand und sein Wirken zu bitten - so kurz nach dem Pfingstfest eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Liebe Schwestern und Brüder,
nach so vielen ernsten Gedanken nun eine kleine Geschichte, die mit der Visitationsreise des emeritierten Bischofs von Würzburg Friedhelm Hofmann 2007 zu tun hat. Als er Schloss Mainberg besichtigte, wies ich ihn auf das Martyrium Liborius Wagners hin. Das Verlies im Schloss wollte er aber auf keinen Fall betreten…